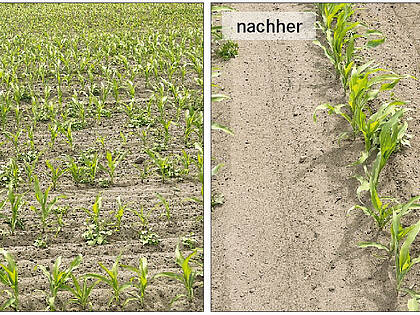Boden, Pflanze und Technik in Harmonie
Alle Register für gesunde Böden: Orgelbaumeister Thomas Sander wechselte vor 20 Jahren in die Landwirtschaft und wurde zum Direktsaatpionier. Mittlerweile entwickelt der technikbegeisterte Seiteneinsteiger auch Maschinen für den regenerativen Pflanzenbau.

© Carmen Rudolph
Die Multiva des Betriebes Sander bei der Direktsaat von Sojabohnen in die vor dem Winter zur Zünslerbekämpfung gewalzten Maisstoppeln.
Der Artikel ist leider nur für Premium-Kunden lesbar
Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Premium-Testzugang an!
Ihre Vorteile:
- Sofortiger Zugriff auf alle Artikel sowie das Archiv
- Topaktuelle Branchen-Nachrichten
- Drucken und Speichern aller Artikel
Sie sind bereits eilbote-Premium-Kunde?
Melden Sie sich jetzt an, lesen Sie diesen und andere geschützte Artikel und genießen Sie Ihre weiteren Premium-Vorteile!
Jetzt einloggen