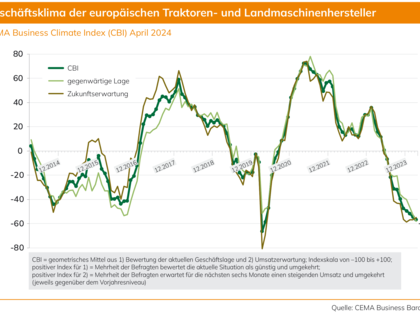Im Osten dominieren Großbetriebe in ländlichen und strukturschwachen Regionen
Ost-West-Unterschiede in der Agrarstruktur weiterhin gravierend – Wettbewerbsvorteile für Großbetriebe – Wirtschaftsschwache ländliche Räume als Problem – Zweigeteilte Förderpolitik – Arbeitskräftemangel nimmt zu

© Adobe Stock / winterbilder
Am 3. Oktober jährte sich der Mauerfall zum 34. Mal.
Die Unterschiede in der Agrarstruktur zwischen Ost und West thematisiert der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, den der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, am 27. September in Berlin vorgestellt hat. Darin verweist die ...
Der Artikel ist leider nur für Premium-Kunden lesbar
Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Premium-Testzugang an!
Ihre Vorteile:
- Sofortiger Zugriff auf alle Artikel sowie das Archiv
- Topaktuelle Branchen-Nachrichten
- Drucken und Speichern aller Artikel
Sie sind bereits eilbote-Premium-Kunde?
Melden Sie sich jetzt an, lesen Sie diesen und andere geschützte Artikel und genießen Sie Ihre weiteren Premium-Vorteile!
Jetzt einloggen